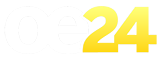Geteilte Meinungen
Machen Videospiele süchtig, oder nicht?
24.03.2014Befürworter werben um Anerkennung, Psychologen warnen vor negativen Folgen.

Die vergangenen zehn Jahre waren für Marvin ein ständiges Auf und Ab. Online-Rollenspiele oder Echtzeit-Strategiespiele bestimmten seinen Alltag. "Man verliert sich, weil man große Begeisterung entwickelt. Man hat auch viel zu lachen", erzählt der 31-Jährige in der Abhängigenambulanz der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Doch was ihn beglückte, machte ihm gleichzeitig das Leben zur Hölle.
"Ich hatte ständig ein unheimlich schlechtes Gewissen. Dann löschte ich alle Spiele, wenig später installierte ich sie wieder neu. Einmal habe ich sogar meinen PC verkauft", berichtet Marvin, der seinen wirklichen Namen nicht nennen möchte. Sein Studium lag weitgehend brach, und an Erfahrungen mit Mädchen mangelte es ihm völlig. Irgendwann habe er sich eingestanden: "Du verhältst dich sehr ähnlich wie jemand, der ein ernsthaftes Drogenproblem hat."
Alternativen helfen in depressiven Phasen
In kleinen Schritten lernt Marvin nun in der Abhängigenambulanz der niedersächsischen Uniklinik, sich von seinem Lieblingsspielzeug zu lösen. Als Alternative hat er Laufen und Fitness entdeckt, das hilft in depressiven Phasen. Besser geht es ihm noch nicht unbedingt, trotz der regelmäßigen Einzel- und Gruppentherapie. "Wenn ich im realen Leben jetzt Positives erlebe, ärgere ich mich, weil ich das alles schon viel früher hätte erleben können", sagt der Student.
Der deutsche Fachverband Medienabhängigkeit kämpft für eine Anerkennung der Computerspiel- und Internetsucht als psychische Krankheit. Im Diagnoseschlüssel der Weltgesundheitsorganisation ICD-10, nach dem Ärzte und Psychologen in Deutschland abrechnen, kommt die PC-Abhängigkeit bisher nicht vor. Das amerikanische Handbuch DSM-5 hat 2013 erstmals Kriterien zur Diagnose einer Computerspielsucht aufgestellt, aber deutlich gemacht, dass es zur Anerkennung als Krankheit weiterer Forschung bedarf.
Nach der neuesten Studie zur Internetabhängigkeit (Pinta-Diari) im Auftrag des deutschen Bundesgesundheitsministeriums ist etwa 1 Prozent der Bevölkerung zwischen 14 und 64 Jahren betroffen. Bei den 14- bis 24-Jährigen gelten 2,4 Prozent und bei den 14- bis 16-Jährigen sogar 4,0 Prozent als süchtig. Wie lange jemand spielt oder sich in sozialen Netzwerken aufhält, ist nach den DSM-5-Kriterien nicht allein ausschlaggebend. Problematisch wird es, wenn beispielsweise Entzugssymptome, Kontrollverlust und die Täuschung Nahestehender hinzukommen.
Ist Medienabhängigkeit also tatsächlich eine Krankheit, möglicherweise gar die Sucht des 21. Jahrhunderts? Oder aber stehen am Anfang psychische Krankheiten wie Depressionen oder soziale Phobien, die die Betroffenen dazu verleiten, sich in virtuelle Welten zu flüchten?
Hersteller wehren sich
"Computerspiele sind keine Krankmacher, kein Gefahrengut", betont der Jugendschutzbeauftragte des Spieler-Herstellers Electronic Arts, Martin Lorber. Es gebe higegen eine lange Tradition, neue Medien zu verteufeln. Ende des 18. Jahrhunderts wurden Romane als wertlos erachtet und vor einer Lesesucht der Frauen gewarnt. Auch Radio und Fernsehen hatten zunächst einen schweren Stand. Doch bis heute fehlen eindeutige wissenschaftliche Belege dafür, dass Gewaltdarstellungen aggressiv machen oder dass Fans von Killerspielen häufiger als Nicht-Spieler als Gewaltverbrecher oder gar Amokläufer enden.
Apps für Smartphones und Tablets machen Games überall verfügbar, wovon die Hersteller profitieren. Der Entwickler des millionenfach heruntergeladenen Spiels "Flappy Bird" hatte die App im Februar auf dem Höhepunkt des Erfolgs zurückgezogen - weil sie ein zu hohes Suchtpotenzial habe. Inzwischen hat er in einem "Rolling Stone"-Interview angekündigt, den flatternden Vogel möglicherweise wieder auf die Nutzer loszulassen - allerdings mit der Warnung versehen, Pausen einzulegen.
Es ist so ähnlich wie beim Alkohol: Millionen von Menschen trinken regelmäßig Bier und Wein, ohne Probleme zu bekommen. Nicht einmal ein Prozent wird abhängig, für sie endet die Sucht im schlimmsten Fall jedoch tödlich. Der Kinder- und Jugendpsychiater Christoph Möller hat täglich mit internetabhängigen Jugendlichen zu tun. Er ist Chefarzt im Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult in Hannover. Gegenüber dem Hauptgebäude liegt "Teen Spirit Island", eine Station für junge Drogenabhängige. Von den 18 Therapieplätzen sind seit 2010 sechs für Internet- und Computerspielsüchtige reserviert.
Die Patienten sind überwiegend 15- bis 17-jährige Burschen. "Im Internet finden sie Erfolge, Beziehungen und Anerkennung, was ihnen im realen Leben bisher kaum gelungen ist", sagt der Mediziner. Am ersten Tag müssen sie den Draht zu ihrem früheren Leben kappen. Das Handy wird ihnen abgenommen, Spielkonsolen und PC sind tabu, nur am Abend gibt es eine begrenzte Fernsehzeit. Grenzen setzen, Strukturen schaffen, Kochen, Werken, Sport und schließlich Schule. So sieht die Therapie aus.
Die Prävention müsste nach Möllers Überzeugung frühzeitig in den Familien beginnen. Der Mediziner sieht keinen Sinn darin, Vorschulkinder und Grundschüler an Computer heranzulassen. "Medienkompetenz beginnt mit Medienabstinenz. Kinderzimmer gehören komplett bildschirmmedienfrei", betont er. Je länger Buben und Mädchen vor der Flimmerkiste sitzen, desto schlechter seien ihre Schulleistungen.
Mädchen verlieren sich eher in sozialen Netzwerken
Ein überraschendes Ergebnis der 2013 abgeschlossenen Pinta-Studie zur Internetabhängigkeit ist, dass mehr Mädchen als Burschen betroffen sind. Sie verlieren sich eher in sozialen Netzwerken, während die Buben sich von Online-Rollenspielen fesseln lassen. Um die Probleme bei den Mädchen in den Griff zu bekommen, ist Möller zufolge nach den bisherigen Erfahrungen aber in der Regel kein stationärer Aufenthalt in der Jugendpsychiatrie notwendig.
Bundesweit bietet inzwischen eine Vielzahl an Kliniken eine Therapie für Mediensüchtige an. Mit den Kassen wird in der Regel über parallel auftretende Krankheiten wie Depressionen oder Schlafstörungen abgerechnet. Das sei ein großer Nachteil, kritisiert Andreas Gohlke, Vorsitzender des Fachverbandes Medienabhängigkeit. Jugend- und Suchtberatungen hätten wegen der noch ausstehenden Anerkennung als Krankheit kein Budget für den Bereich Internetsucht zur Verfügung.
"Es ist definitiv kein Jugendphänomen", betont Gohlke. Nach BIU-Angaben stieg die Zahl der Spieler über 50 Jahre in diesem Jahr um 12 Prozent auf 7,3 Millionen Spieler im Vergleich zu 2013. Ältere finden häufig den Einstieg über Spieleklassiker wie Skat oder Doppelkopf, die sie dann auch in digitaler Form begeistern.
Die Fürsprecher der digitalen Spiele setzen sich für die Anerkennung als Kulturgut ein. Benjamin Rostalski war Spielesichter der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) und arbeitet jetzt für die 2012 gegründete Stiftung Digitale Spielkultur. "Viele Spiele sind kulturell wertvoll", betont er. Auch für Kinder gebe es gute Apps. Es sei nun einmal Realität, dass sich schon Zwei- bis Fünfjährige mit dem iPad beschäftigen. "Ganz wichtig ist es, das mit den Kindern zusammen zu machen und sie dabei zu beobachten - wie beim Vorlesen", sagt Rostalski. "Digitale Spiele dürfen nicht als Babysitter missbraucht werden."
Eltern in der Pflicht
In diesem Punkt sind die Suchtforscher und Psychologen gar nicht so weit entfernt von der Unterhaltungssoftware-Branche: Beide sehen in erster Linie die Eltern in der Pflicht, die nicht erst einschreiten sollten, wenn der Nachwuchs in der Pubertät ist und sich nichts mehr sagen lassen will. Alle Spielkonsolen hätten die technischen Voraussetzungen, die Altersfreigabe und das Zeitbudget festzulegen, betont Martin Lorber vom Spieleanbieter Electronic Arts. "Eltern können es so einrichten, dass sich die Geräte jeden Tag nach einer vereinbarten Zeit von selber abschalten."
Fotos: 20 Gaming-Blockbuster die 2014 starten