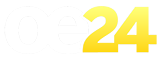Beethovens Meisterwerk
"Fidelio" erntet Buhrufe an der Volksoper
27.05.2014
Seit dem 25. Mai steht das Beethoven Werk nach 73 Jahren wieder am Spielplan.

Einen besseren Zeitpunkt hätte die Wiener Volksoper für ihren ersten "Fidelio" nach 73 Jahren am Sonntagabend nicht finden können: Am 23. Mai jährte sich die Uraufführung der endgültigen Fassung im Kärntnertortheater zum 200. Mal. Und überdies hat der ESC-Sieg von Conchita Wurst das Thema Gender-Crossdressing, dessen sich auch Fidelio bedient, zum nationalen Gesprächsthema gemacht.
Guter und schlechter Teil
Trotz dieser guten Rahmenbedingungen endete der Premierenabend jedoch mit einem Buhkonzert für das Regieteam um Markus Bothe. Bothe und sein Bühnenbildner Robert Schweer bieten eine Inszenierung, die in sich disparat ist und heillos in zwei Teile zerfällt. Der 1. Akt spielt in einem US-amerikanischen 1950er-Jahre-Idyll mit weißem Gartenzaun samt Kunstrasen und blauem Himmel. In diesem simplen, für Beethovens Freiheitswerk unpassenden Operettensetting fehlt es auch noch über weite Strecken an Personenführung.
Der 2. Akt hingegen wird von einem technoiden Gefangenenturm im Schwarz-Weiß-Ambiente dominiert. Höher könnte der beabsichtigte Kontrast zwischen diesem hochästhetischen Minimalismus und der ersten Hälfte nicht sein. Das, was man zu Beginn vermisste, ist nun möglich: Auf einmal wird der Raum mittels Drehbühne und intelligenter Leitung der Sänger auch genutzt.
An der Spitze der Sängerriege steht die US-Amerikanerin Marcy Stonikas, die bei ihrem Europadebüt von Kostümbildnerin Heide Kastler stilistisch in Karl Moik verwandelt wurde. Sie schmettert als Leonore mit starkem Vibrato die Arien ihres Alter Egos Fidelio, ihr zur Seite mit ebenfalls voluminösem Bass Stefan Cerny als Gefängniswärter Rocco.
Sebastian Holecek legt seinen Don Pizarro als diabolischen Strizzi an und wird dabei am Ende von der Regie - respektive den Freigelassenen - geköpft, anstatt ins Gefängnis geworfen. Nicht nur um seine Freiheit, sondern auch mit seiner Partie kämpfte hingegen Roy Cornelius Smith als Florestan: Er forciert, übersteuert dabei und singt seinen unschuldig Gefangenen wenig nuanciert.
Umso erfreulicher waren da die Klänge, die aus dem Orchestergraben kamen. Dort nahm die britische Dirigentin Julia Jones ihren Beethoven trocken, bisweilen zackig und ließ dabei doch stets den Sängern den Vortritt. Im Gegensatz zur Regie eine durchgängig hohe Leistung.